Erfolg ist vielfach situativ bedingt
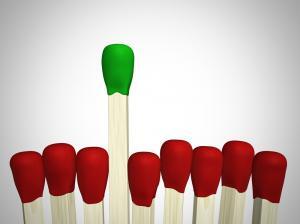
styleuneed.de / Shutterstock
Chengwei Liu sieht sich durch empirische Untersuchungen darin bestärkt, dass der Erfolg von Managern oftmals nicht auf deren überlegene Fähigkeiten zurückgeführt werden könne, sondern eher in günstigen internen oder externen Umfeldkonstellationen begründet sei. Außergewöhnliche Erfolge beruhten auf außergewöhnlichem Glück. Normal sei vielmehr, dass eine Erfolgsbilanz über die Zeit durchschnittlich sei. Aktuell unterfüttert Rainer Hank, verantwortlich für die Wirtschafts- und Finanzredaktion der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, diese Aussage u.a. mit Verweis auf das neue Werk von Robert H. Frank (2016) dahingehend, dass die Komponente Zufall bei der Bemessung des Erfolgs im Management beständig unterschlagen werde.
Wichtig: Beide betonen allerdings einhellig, dass der Weg nach oben vor allem von denjenigen geschafft werde, die überdurchschnittliche Kompetenzen (nebst entsprechender Anstrengungsbereitschaft) besäßen. An dessen Ende versammelten sich aber Personen, die über mehr oder minder ähnliche biografische Hintergründe und berufliche Erfahrungen verfügten. Konkret mit Liu gesprochen: „Sie (…) reden gleich, sie kleiden sich gleich, sie waren auf den gleichen Universitäten, sie haben die gleichen Netzwerke und die gleiche Denkweise.“ Wirkliche Unterschiede in der Fähigkeit und Ausstattung gäbe es bei diesen Topmanagern am Ende nicht mehr, wie wohl auch hier seltene Ausnahmen die Regel bestätigten.
Losentscheid als Ausweg?
Ausgehend von der These, dass die Kandidaten für Spitzenpositionen in der Regel gleich gut und sehr ähnlich seien, folgert Liu im Weiteren, dass es deshalb auch nicht sinnvoll sei, einen aufwendigen Auswahlprozess zu betreiben, der einen deutlich Besten zu identifizieren beabsichtigt, wo alle weithin gleich sind. Allenfalls gilt: Wer hier eine risikoreiche Strategie fahren wolle, der solle einen CEO mit einer Biografie wählen, die so ganz anders sei als die seiner „Standardkollegen“ (beachte: CEOs sind ganz überwiegend männlich. Siehe dazu auch: Frauen als Fremdkörper im Management?).
Ein Losverfahren würde, so Liu, im Übrigen auch ein weiteres Problem lösen: Da die aussichtsreichen Kandidaten für eine Spitzenposition bei den üblichen Auswahlverfahren alles daran setzen würden, ihre eigene Karriere den bekannten Spielregeln entsprechend zu befördern, würden wertvolle Ressourcen eher in die mikropolitische Pflege und Durchsetzung der eigenen Karriere als in das Wohl der Organisation investiert. Wüssten die Kandidaten aber, dass ab einer gewissen Stufe die Beförderung per Losentscheid erfolge, würden solche aus Organisationssicht sinnlosen, möglicherweise gar gefährlichen Aktivitäten ab dieser Stufe minimiert. In diesem Zusammenhang verweist er auf einige geschichtliche Beispiele, die in der Tat zeigen, dass Spitzenpositionen zuweilen per Losentscheid vergeben wurden.
Hintergründe zum Losentscheid
Ein erstes Beispiel liefert das antike Griechenland, wo politische Ämter u.a. per Losverfahren vergeben wurden. Auch in der venezianischen Republik wurde, um ein anderes Beispiel zu geben, der Doge, also das Staatsoberhaupt, in einer komplizierten Mischung aus Wahl- und Losverfahren bestimmt. Und sogar in der heutigen politischen Theorie findet sich die Vorstellung, Beiräte oder Stadtparlamente teilweise durch Losentscheid zu bestimmen. Völlig abwegig ist der Vorschlag also nicht, auch wenn Effektivität oder Effizienz nicht beständig die tragenden Leitmotive solcher Entscheidungen sind.
Als gute Gründe für ein Losverfahren lassen sich nämlich auch folgende Effekte ins Feld führen: Eine Minimierung von Willkür, ein Abbau unqualifizierter Parteinahme und/oder eine Begrenzung machterhaltender Elitenbildung zugunsten einer zufallsverteilten Zusammenstellung von Interessen und Fähigkeiten. Hinzu treten im historischen Kontext Vorstellungen, dass die Götter per Losentscheid einen gerechten Ausgleich zwischen Ambitionen von Menschen herbeiführen. Der große deutsche Sozialpsychologe Peter R. Hofstätter hat dazu einmal in einem von mir mitherausgegebenen Werk viele Kulturbeispiele unterschiedlichster Ausprägung vorgestellt. Dort geht es fast immer um die Regulierung eines Übermaßes an Glück für eine einzelne Person zugunsten eines Nicht-Abhebens des Individuums und des Friedens in der Gemeinschaft. Aus Schillers Ballade „Der Ring des Polykrates“ (1797) zitiert er beispielsweise folgende Denkfigur (1990, S. 17f.):
„Es ist zwar erfreulich zu erfahren, dass es einem lieben Gastfreund gutgeht. Mir gefällt aber dein großes Glück gar nicht; denn ich weiß, dass die Gottheit neidisch ist. Ich sehe es lieber, dass ich selbst und meine Freunde einmal in ihren Unternehmungen Glück, ein anderes Mal aber Misserfolg haben und das es uns so in unserem Leben abwechselnd geht, als dass ich in allem erfolgreich bin. Noch kenne ich vom Hörensagen keinen, der nicht zuletzt ein ganz klägliches Ende nahm, wenn er in allen Glück hatte“
Damit verbunden ist auch gleich ein Handlungsprinzip für den, der zu viel Glück erfährt:
„Überlege dir, was du unter allen deinen Gütern wohl für das wertvollste hältst und über dessen Verlust du am traurigsten wärest! Das wirf weg, damit es nicht mehr in Menschenhände kommen kann“.
Damit wäre der Neid der Götter wohl zu vermeiden, der Zorn der Aktionäre nicht. Deshalb kann dieses Vorsorgeprinzip zur Vermeidung eines externen Eingriffs hier nicht erwartet werden. Ganz im Gegenteil haben wir das praktische Problem, dass Anreizsystem, antizipierte Erwartungen und ggf. narzisstische Überhöhungen einer CEO-Persönlichkeit das rastlose Anhäufen von Erfolg antreiben (hier in Form einer überdurchschnittlichen Performance gemeint). Das empirische Faktum, dass Durchschnitt und geringe Abweichungen hiervon absolute Normalität sind und definitorisch sein müssen, wird ignoriert.
CEO-Wechsel haben Einfluss auf den Führungserfolg
Wie steht es aber mit der Aussage, dass der CEO oder das Top Management Team keinen Einfluss auf die Performance besitzt? Sie ist in dieser Absolutheit eher falsch. Allerdings: der Grad des Einflusses ist nicht genau bestimmbar und variiert natürlich.
Die Führungsforschung tut sich aus methodischen Gründen extrem schwer, eine verbindliche Aussage zu formulieren. In meiner Personalführung (2016) habe ich die Essenz der Diskussion genauer beschrieben. Danach wird der Einfluss im Schnitt zwischen 5% und 20% auf die Unternehmensperformance gesehen (ein Maß hierfür ist u.a. die Gesamtkapitalrentabilität oder Tobin’s q), im Guten wie im Schlechten.
Der Einfluss vollzieht sich vor allem über strategische Entscheidungen, strukturelle und kulturelle treten hinzu, Brancheneinflüsse sind aber sehr bedeutsam. Zu diesen Zahlen kommt man durch Vorher-Nachher Untersuchungen von CEO-Wechseln für definierte Zeiträume unter Beachtung einer Fülle von Kontrollvariablen. Und: Selbst dieses Wissen hat man erst nach aufwendigen wissenschaftlichen Berechnungen. Ulrich Goldschmidt, Vorsitzender des Führungskräfteverbandes DFK, sagt so auch mit Blick auf die Führungspraxis und das Daily Business (2016): „Sie können in der Regel nicht statistisch messen und mit mathematischer Exaktheit sagen, ob Leistungen erbracht wurden“
Was bei dieser Art von Studien nicht möglich ist, ist diese Unterschiede auf generalisierte Fähigkeitsprofile der CEO stabil zurückzuführen. Möchte man hierzu mehr wissen, sind Persönlichkeitsprofile oder Fähigkeitsausweise von CEOs erfolgreicher Unternehmen im Vergleich zu analysieren. Aber auch hier sind die Ergebnisse aus theoretischen wie methodischen Gründen begrenzt. Illustrative Fallanalysen sind immer anschaulich, durchaus lehrreich, aber fragwürdig bezüglich ihrer Generalisierbarkeit. Dies wissen wir ja schon gleichermaßen von den beliebten „Best Practice-Analysen“.
Verbinden wir diese Befunde mit der sehr eingeschränkten Prognosevalidität von Personalauswahlverfahren auch für das Top-Management, so ist es in der Tat möglich, für einen angesichts des Kontextes (!) gut ausgewählten Bewerberkreis als letzten Schritt eine Losentscheidung vorzusehen – vorausgesetzt, andere, nicht fähigkeitsbezogene Kriterien sind nicht zwischen den Kandidaten signifikant zu entdecken (z.B. der positive Bekanntheitsgrad, der einen leichteren Zugang zur Presse verspricht oder die angenommene persönliche Passung („Chemie“) mit dem Top Management Team).
Die Hypothese wäre, dass die Performance mindestens gleich gut wäre, dass das Verfahren aber nach Eintritt in einen, sagen wir einmal „CEO-Pool“, ausweisbare Suchkosten wie intangible, durch Mikropolitik entstehende Kosten reduzieren und die Bedeutung verzerrender Entscheidungskriterien minimieren würde.
Nun, wir haben also einen begründbaren Vorschlag auf dem Tisch; allein, was fehlt und angesichts Besetzungspraxis fehlen muss, sind Daten, die Wissenschaftlern eine empirische Beweisführung ermöglicht. Aber dafür kann ja nun jede Organisation selbst sorgen. Unsererseits schreiben wir die Idee abschließend einmal fort.
Bundesliga-Trainer per Losentscheid?– Ein Gedankenexperiment
Was für Top-Positionen in Unternehmen gilt, sollte analog auch für Top-Positionen im Sport gelten. Deshalb – zur nochmaligen Verdeutlichung der Idee und v.a. auch zur persönlichen Reflexion dieser Idee – zum Ende ein kleines Gedankenexperiment: Was wäre, wenn Liu doch recht hätte …
Gängige These
Das beste Team kann nur das beste Team bleiben, wenn es den besten Trainer hat. Ergo: Der FC Bayern München engagiert Josep (Pep) Guardiola, den faktisch erfolgreichsten Trainer aller Zeiten.
Anti-These (gemäß Liu)
Alle 18 Trainer die in der Fußballbundesliga arbeiten, sind mehr oder minder gleich(extreme Annahme, gültig aber danach sicher für diejenigen, die bereits bemerkenswerte Erfolgsbilanzen haben). Von daher wäre es möglich, den Trainern zu Saisonbeginn Mannschaften zuzulosen, ohne dass sich am Erfolg der Mannschaften substantiell etwas ändern würde. Sprich: Würde bspw. Peter Stöger (derzeit FC Köln) dem FC Bayern zugelost, so würde (auch) er das Double gewinnen können! Und würde Pep Guardiola der 1. FC Köln zugelost, so würde auch der 1. FC Köln keinen Titel gewonnen haben und Pep Guardiola das Attribut des Star-Trainers schnell verlieren.
Konsequenz
Es braucht keinen Markt für Star-Trainer mit exorbitanten Vergütungen. Erfahrene Trainer sind vielmehr relativ austauschbar, alles andere ist eine „Romance of Coaching“. Ergo: Auch der Trainer von Island hätte mit der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft das EM-Halbfinale erreicht – mit Glück (oder einer zufällig besseren eigenen Tagesform) sogar gewonnen.
Finden Sie das abwegig? Gerade der Sport kennt Vorkehrungen, die vermeiden, dass einseitige Zuweisungen erfolgen, die nur noch begrenzt das individuelle Leistungsvermögen spielen lassen. So wird im Modernen Fünfkampf der Reiter einem Pferd zugelost. Dies wäre mit der obigen Logik unmittelbar vereinbar. Die nordamerikanischen Profisportligen wie die NHL oder NBA gehen einen anderen Weg. So werden die dort nach Wertigkeit gerankten Nachwuchsspieler zunächst dem Zugriff (Pick) der schwächeren Teams in festgelegter Reihenfolge anheimgestellt, manchmal kombiniert mit Zufallselementen (Draft Lottery).




